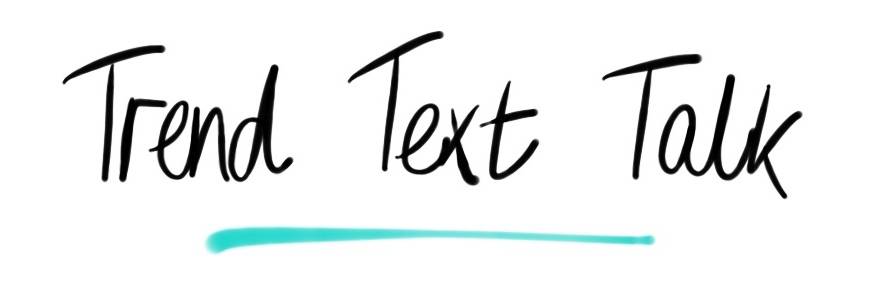Co-Individualisierung: Von Hygge zu Dugnad
In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Begriffe lokal-nationaler Kulturphänomene “exportiert” und erfolgreich vermarktet. So hat sich um den Ausdruck “Hygge” eine ganze Mode-Industrie gebildet. Daneben machten auch Ikigai, Lagom oder Sisu Karriere.
Jene Wörter, die beispielsweise aus dem Skandinavischen, Finnischen oder Japanischen stammen, sind hilfreich, um eine Sehnsucht oder einen neuen Wert zu beschreiben, für dessen Komplexität es in unserer Sprache kein Äquivalent gibt.
Dugnad: gesellschaftlich verpflichtende Freiwilligenarbeit
Das trifft auch für Dugnad zu. Der in Norwegen 2014 zum Nationalwort gekürte Begriff steht dabei für viel mehr als die vom Wörterbuch vorgeschlagenen Übersetzungen Nachbarschaftshilfe oder Freiwilligenarbeit. Dugnad ist „Freiwilligkeit mit Verpflichtung und Verantwortung, mit Verbindlichkeit und Gewissenhaftigkeit“. Dugnad ist ein Haltung. Dugnad kann sich niemand ohne guten Grund entziehen. Während die Liste an Ehrenämtern, die jemand belegt, in Deutschland gerne zum Schmücken des eigenen Lebenslaufes dient, ist „Dugnadsarbeid“ hierfür nicht geeignet. Eher ist es umgekehrt: Eine Abwesenheit an jenen gemeinschaftlichen Arbeiten und Engagements fällt auf. Dugnad ist freiwillig und gleichzeitig auch wieder nicht.
Doch auch in Norwegen nagen Individualisierung und Kapitalisierung an dem Prinzip. Und dennoch: so nimmt die Anzahl der Jüngeren unter den Engagierenden zwar ab, der Großteil der in Norwegen lebenden Personen ist jedoch jährlich in Dugnads-Einsätzen tätig. Und eine häufige Antwort der Jüngeren, warum sie bisher nicht aktiv waren: Es hat sie bisher niemand gefragt.
Zwar hat die Kommerzialisierung den norwegischen Dugnadsgeist aktuell stark im Griff (von Toilettenpapier bis Apfelwein), doch das Prinzip wird künftig aktueller denn je wieder aufleben. Verantwortlich sind dafür die aus den Megatrends entstehenden neuen gesellschaftlichen Lebensumstände.
Was kann Dugnad, was Hygge & Co nicht können?
Von Hygge bis Lagom und von Sisu bis Ikigai wurden jene Lebensgefühle speziell im Kontext einer persönlichen „Glücksmaximierung“ und „Self-Care“ angepriesen. Auch bei Dugnad geht es um einen persönlichen Mehrwert – doch dieser steht im Kontext einer Co-Individualisierten Gesellschaft.
Beobachtet man nun die Entwicklung des Megatrends Individualisierung, kann eine Veränderung von „Ich-zentriertheit“ zu einer „Ich-Im-Wir-Fokussierung“ registriert werden. Das Individuum arbeitet immer noch am persönlichen Wohlbefinden, jedoch entweder verstärkt mit anderen gemeinsam oder um für andere da sein zu können. Das Miteinander ist demnach wenig altruistisch motiviert, sondern weiterhin stark individualistisch, der generierte Mehrwert unterliegt jedoch dem Wir-Charakter der Co-Individualisierung.
Das Potenzial von Dugnad:
Dugnad kann demnach als Prinzip und Narrativ verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen und eine Lösung anbieten. Das impliziert zum Beispiel die alternde Gesellschaft, den Fachkräftemangel, betrifft Einsamkeit und Selbstwirksamkeit ebenso wie Kollaboration bis Resilienz.