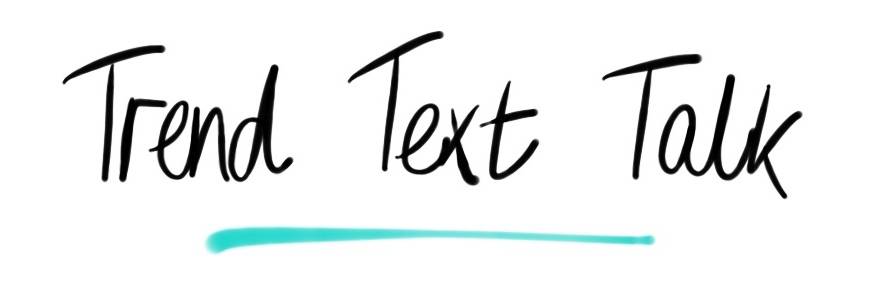Derzeit wird in allen Branchen und Bereichen viel daran gearbeitet „zurück zur Normalität“ zu kehren. Dieser Begriff als solcher ist aus Perspektive der Zukunfts- und Trendforschung schon schwierig. Zum einen ist es die Frage welche Normalität gemeint ist. In unserer ausdifferenzierten, individualisierten und auch überkomplexen Welt ist es schwer mit diesen Allgemeinschauplätzen zu arbeiten.
Die Normalität von Venedig war Overtourism, die Normalität des kleinen Heilbäderorts inmitten von Deutschland war eher ein Kämpfen um Gäste. Die Normalität der Kreuzfahrtindustrie und des Massentourismus ein 24/7-Angebot an Zugang, Verfügbarkeit und käuflich erwerbbarer Grenzenlosigkeit, die Normalität vieler Nischensparten der Fokus auf temporäre oder anderweitig beschränkte Exklusivität, die – Beispiel Trekkingplätze – nicht zwangsläufig exklusiv im finanziellen Sinne sein musste.
Zum anderen ist die Frage relevant, welche Veränderungen und Trends bei den „Normalitäten“ zu beobachten sind. Findet man einen gemeinsamen Nenner ein prä-Corona Normalität, dann war es eine seit Jahrzehnten weltweit wachsende Tourismus- und Freizeitindustrie, von dessen Existenz ganze Länder teilweise abhängen. Doch es war auch eine bereits vor Corona gebeutelte Industrie, die sich gegenseitig kannibalisiert hat. Preiskämpfe und Dumping, Ignoranz gegenüber eigenen Ressourcen (Mensch, Natur, Ökosystem), Over- und Undertourism.
Der Peak war vor Corona erreicht – also zurück zur Normalität?
Die Akteure der Branche hätten jetzt die Chance sich neu zu positionieren, teilweise wird das auch durchaus gemacht. Das Brachliegen der Branche hat einerseits ihre Empfindlichkeit demonstriert, aber auch ihre Exklusivität neu hervorgehoben. Mobilität und Unterwegskultur sind aktuell nicht mehr selbstverständlich. Neue Ziele kommen bei den Reisenden auf den Schirm. Viele klassische Geschäftsreisen werden mittelfristig obsolet werden (Zoom & Co machen es möglich). Hybridformen wie Bleisure oder Workation dagegen ansteigen. Reisen wird heute und in Zukunft anders wahrgenommen, verletzlicher, besonderer, wertiger.
Einlassen auf Langsamkeit, Ungewissheit und Risiko
Und das ist eine Chance, denn wenn jetzt einzelne Orte und Institutionen begrenzte Gäste zulassen, kann das das Reisen wieder auf das Niveau des wirklich Besonderen heben. Andererseits können all jene, weniger bekannten Orte und Institutionen dadurch neues Potenzial erhalten und aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Interessant für sie, ist die Generation an Reisenden, die jeden Kontinent bereits erlebt hat, aber jetzt das Microabenteuer entdeckt. Das Unbekannte, das Einlassen auf Langsamkeit, Ungewissheit und Risiko.
Resonanz statt Vorhersehbarkeit
Die Fragilität der Tourismusindustrie als Branche hat für den Reisenden plötzlich eine Komponente, die viele ja speziell auch unterwegs suchen: In “exklusiveren” (nicht zwangsläufig gleich “teueren”) Tourismusangeboten lassen sich Resonanzmomente erfahren. Dann ist Veränderung möglich – beim Reisenden, aber auch durch seine Wirkung auf das ihm Begegnende. Im Kontrast dazu jene Räume auf den Kreuzfahrtschiffen, in den standardisierten Ressorts, den Party-Locations, wo alles vorhersehbar und eingespielt abläuft. Das kann Sicherheit generieren, kurzfristigen Spaß bereiten (wenn das Vertrauen wiederhergestellt ist), aber einen nachhaltigen Effekt im Sinne einer Resonanzerfahrung, einer wirklichen Beziehung lässt sich dort weniger generieren als in offenenReiseformen, die Platz für Gestaltbarkeit implizieren.
Mehr zum Resonanztourismus finden Sie u.a. hier. Oder Sie melden sich bei mir, wenn Sie eine Vortrag zum Thema (klar auch remote), ein White-Paper oder Beratung wünschen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!