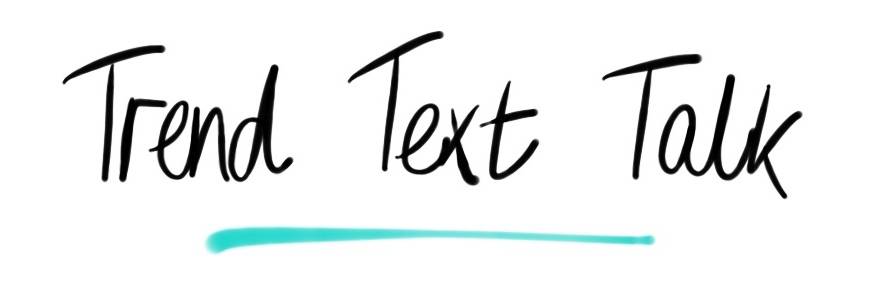Zur zweiten Frage: Habe ich mich schonmal mit meinen Prognosen und Beobachtungen geirrt? 3 Beispiele…
1. Auf den Durchbruch von “Zero Waste” und wie das Phänomen Precycle (also bevor der Müll überhaupt anfällt) Wirtschafts- und Handelswege verändert, warte ich noch vergeblich. Die ersten Unverpackt-Läden schließen und von einem wirklichen Umdenken in der Gesellschaft spüre ich weder beim Betrachten der Regale noch der Laufbänder an den Kassen etwas. Vielleicht ist hier mein innerer Wunsch der Autor gewesen. Allerdings brauchen manche Entwicklungen auch etwas Zeit und manche bewegen sich dann aber auch nicht aus der Nische heraus. Zum Beispiel, weil technologische oder gesellschaftliche Entwicklungen sie überflüssig machen.
2. Im Trendreport 2012 hatte ich im Kapitel Moodness darüber spekuliert, dass der “Glückswelle”, der Flut an Ratgebern und Dienstleistungen der neoliberalen Welt zum “positiven Denken”, eine neue Ära mit dem Recht auf Schwermut, Trauer und Melancholie entgegengesetzt wird. Schaue ich mich im Zeitschriftenmarkt um, gibt es weiterhin eine Flut an “Happyness”-Magazinen. Zwar wird dem Thema “negativer” Emotionen mehr Raum gegeben, allerdings in der Regel mit Hinweisen, wie diese zu überwinden sind und was man dagegen tun kann. Eine Gleichberechtigung ist noch weit entfernt. So mag zwar auch das “Scheitern” mittlerweile gesellschaftsfähig sein und auch Bestandteil moderner Start-Ups, aber auch hier geht es stets darum, was am Ende Positives dabei herausgekommen ist. Das Recht auf Schwermut, Trauer und Melancholie ist nur dann gesellschaftlich akzeptiert, wenn am Ende des Tages eine Überwindung oder ein positiver Nutzen daraus entsteht. Das Thema Emotionen als Ganzes hingegen beschäftigt und verändert derzeit Gesellschaft. Aber dazu demnächst mehr.
3. Bis vor einigen Tagen hätte ich noch gesagt, dass ich mich im Fall der “Trocken-Trinker“, wie ich sie in “Die neue Trendsetter” 2013 tituliert habe extrem geiirt habe. Generell war die Studie ja darauf ausgelegt, Lebensstile in Nischen zu finden, die sich mit der Zeit gesellschaftlich etablieren. Bei einigen ist das durchaus der Fall, andere verharren noch in der Nische, sind aber weiter präsent. Bei den “Trocken-Trinkern” hingegen hatte ich meinen Zweifel, ob sie überhaupt existierten. “Sobriety as a lifestyle” war die These, eine neue Abstinenzwelle, die nichts mit Pietismus, Verzicht und Langeweile zu tun hat, sondern über kurz oder lang Alkohol gesellschaftlich so unangemessen wie das Rauchen werden lässt. Klar, gibt es Personen, die im Zuge von Yoga, Sport und Gesundheit kaum oder gar keinen Alkohol konsumieren. Die Palette an alkoholfreien Bieren ist eklatant gewachsen. Doch so wirklich zum “identitätsstiftenden Moment”, wie meine These war, wurde es nicht. In den letzten Wochen bin ich jedoch über Artikel gestolpert, die ihr wieder Futter geben: “Sober is the new drunk: why millennials are ditching bar crawls for juice crawls” titelte The Guardian bereits im April 2016. Kristi Coulter verglich in ihrem Artikel, der übersetzt in der Zeit als “Die betrunkene Frau” erschien, den Wein mit einem Instamgramfilter, den man über das eigene Leben legt, um nicht sehen zu müssen wie fahl und brüchig es eigentlich ist. In jedem Fall ein Thema das es wert ist, weiter zu beobachten. Vielleicht auch mit Berücksichtigung welche Rolle Achtsamkeit und eine emotional reifere Gesellschaft spielen.