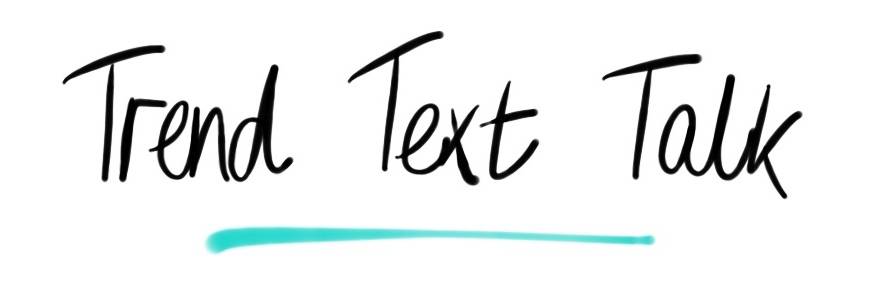Frauen im Sport – da kommt nicht selten die Vermutung auf, dass wir das Jahr 1960 schreiben. Nur langsam scheint der Gender Shift die Wirklichkeiten des Sportalltags einzuholen. Doch im Kontext Sportgesellschaft lässt sich der Trend zum Frauensport und Frauenspitzensport nicht aufhalten. Die Ereignisse überschlugen sich fast in den letzten Stunden – nicht zuletzt die Tatsache, dass die Schweizer Radsportlerin Nicole Hanselmann beim belgischen Rennen „Omloop Het Nieuwsblad“ zu schnell für die männlichen Teams fuhr, macht die notwendige Debatte über Geschlecht und Sport mehr als deutlich.
Der Gender Pay Gap im Sport: Ein Echo aus den Tiefen
Spitzensportlerinnen verdienen nicht nur etwas weniger, sondern der Gender Pay Gap ist hier so groß, dass ein langanhaltendes Echo aus dieser Lücke tönt. Bereits 2017 lag der Fokus der Global Sports Salaries Studie auf genau diesem Punkt. “A key finding of our ‘audit’ is that for every professional female footballer in the world, there are 106 men making a full-time living from the game, at least. Not only that, but the women who do make it earn as little as one hundredth the sums of their male counterparts – even if they are among the elite.”
Während in Norwegen seit 2018 die Fußballerinnen vom Norwegischen Fußballverband (NFF) ein gleich hohes Gehalt bekommen wie ihre männlichen Kicker, verklagen die Frauen in den USA jetzt ihren Verband U. S. Soccer wegen institutionalisierter Diskriminierung. Am Weltfrauentag 2019 haben 28 Spielerinnen die Klageschrift eingereicht, die neben der geringeren Bezahlung auch schlechtere Allgemeinbedingungen auflistet. Ob Trainingsplatz oder Trainingszeiten, Coaches oder medizinische Versorgung, selbst die Reisebedingungen zu den Spielen würden sich in der Qualität von jenen ihrer männlichen Kollegen unterscheiden. Und das, obwohl die Damen in den USA sogar erfolgreicher sind – seitens der Ergebnisse wie auch der Zuschauerzahlen.
Adidas hat ebenfalls am 8. März 2019 verkündet, dass die Prämien für seine Frauenfußball-Teams bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer gleich hoch sein werden, wie jene, die im vergangenen Jahr den Männern gezahlt wurden. Vorausgesetzt der WM-Titel wird geholt.
In England dürfen die Fußballerinnen bisher besser nicht krank werden oder sich langwierige Verletzungen zuziehen. Laut Footbal Leaks und Spiegel.de kann den Spielerinnen gekündigt werden, wenn sie länger als 3 Monate ausfallen. Premier League Spieler hingegen erst nach 18 Monaten. Die maßgeschneiderten Anforderungen seien notwendig, so der englische Fußballverband FA, um den Frauenprofifußball nachhaltig gewährleisten zu können. Dennoch sollen die Verträge 2019 überarbeitet und angepasst werden. Das Ziel der FA ist es schließlich bis 2020 die Zahl der Fußball spielenden Mädchen zu verdoppeln.
In anderen Sportarten sind die Lücken mitunter nicht ganz so groß, aber immer noch gewaltig. Über dreimal soviel bekamen die Skispringer im Teamspringen bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld für einen Sieg im Einzelwettkampf vom Ski-Weltverband Fis ausgeschüttet, und sogar siebenmal mehr im Teamwettkampf als die Skispringerinnen (vgl. hier). Die Skispringerinnen hatten ja so oder so einige geschlechterdiskriminierenden Hürden nehmen müssen. Dass die Sportart erst seit 2014 olympisch ist (90 Jahre nach der Zulassung der Männer), ist dabei nur ein Punkt. Gegenwind erhielt bis dahin der Frauen-Skisprung von Männern, die mit biologistischen Argumenten aufwarteten. So wurde nicht nur vor der “physischen wie psychischen Vermännlichung” gewarnt, sondern bis ins ausgehende 20. Jahrhundert der Mythos einer Verschiebung der Gebärmutter oder sogar vom Platzen des Uterus verbreitet (vgl. Hofmann, Annette R.: Frauen erobern sich die Lüfte. In: Ariadne 69, S. 67f). Wenn es nicht die medizinischen (nicht haltbaren) Gründe waren, dann wurde die mangelnde Technik ins Feld geführt (auch gerne noch heute, um Lohnungleichheit zu rechtfertigen). Ohne jedoch dabei zu erwähnen, dass – ähnlich wie bei den Fußballerinnen in den USA – die Bedingungen häufig schlechtere sind: Wurden Wettkämpfe wegen schlechter Wetterverhältnisse bei Männern abgesagt, wurden sie in der Vergangenheit bei den Skispringerinnen durchgeführt (vgl. Hofmann ebd.).
Wo bleibt jetzt der Trend?
Es lassen sich Veränderungen beobachten.
1. die Sportlerinnen wehren sich offiziell und klagen wie am Beispiel USA ihre Rechte in.
2. Die Medien berichten vermehrt über die Ungerechtigkeiten, etwa wie am Beispiel Skisprung oder der Kündigungsklausel der Women’s Super Leauge.
3. Männer übernehmen Verantwortung und setzen sich für mehr Gleichberechtigung im Sport ein, wie die australische Organisation Male Champions of Change u.a. mit ihrem aktuellen Report “Pathway to Pay Equality” zeigt.
4. Die Marken haben das Thema (und die Kundinnen) entdeckt. Adidas hat die She Breaks Barriers Initiative gestartet, um die mediale Präsenz von Sportlerinnen zu fördern. Neben mehr Sichtbarkeit weiblicher Rolemodels in den Medien, möchte der Konzern in lokalen Communities die Hürden für Mädchen verringern, Sport zu treiben sowie zusammen mit Frauensportorganisationen stärker an dem Thema arbeiten. Für das Marketing sicherlich gut.
Und im Breitensport?
Viele Sportvereine haben Frauen leider immer noch zu häufig als Gesundheitssportlerinnen oder „Mütter“ auf dem Schirm. Es wird in alten Rollenklischees und binärem Geschlechterverständnissen gedacht und diese auch kommuniziert. Gleichzeitig fehlt in vielen Vereinen ein generelles Bewusstsein für oder auch Wissen über die eigene Geschichte von Geschlechterdiskriminierung. Speziell in Vereinen mit langer Historie scheint das Thema Partizipation von Frauen, wenn überhaupt, nur dann interessant zu sein, wenn es Positives zu berichten gibt. Über Ausschluss und Hürden, Diskriminierung und Denkblockaden ist so gut wie nichts zu erfahren. Dabei beginnt Trendforschung und Zukunftsausrichtung gerade auch in der Vergangenheit. Das Bewusstwerden dieses Prozesses ist für die Ausrichtung von Vereinen speziell in einem Zeitalter des Megatrends Gender Shift essentiell.
Denn die Fragen, die sich Vereine heute stellen müssen, ganz gleich ob den Leistungs- oder Breitensport betreffend, gehen weit über das Thema eines binären Geschlechterverständnisses hinaus. Doch gerade dafür ist es wichtig, sich dem Diskurs zu stellen und eine eigene, ehrliche Bestandsaufnahme zu machen.
Für die Zukunft sind (neben Lohngleichheit und einer egalitären medialen Repräsentanz) das Überdenken von Angeboten und Kommunikationsformen notwendig und neue Konzepte für Sportveranstaltungen erforderlich. Konzepte, die jenseits von Geschlecht, Teilnahme für alle Sportler*innen möglich machen. Sportveranstaltungen jenseits eines Leistungsprinzips und der Frage, wer wieviel Testosteron hat und wo mitmachen darf/muss/kann. Im fortschreitenden 21. Jahrhunderts müssen Bewegung, Gemeinschaft und Erfahrungen in den Fokus von „Wettkämpfen“ rücken. Die neue Sportart Quidditch ist hier ein anderes Beispiel, wie Integration in Teamsport und den klassischen Wettkampf integriert werden kann. „Von den sieben Spieler*innen auf dem Feld dürfen sich maximal vier mit dem gleichen Geschlecht identifizieren. Auf diese Weise sind Spieler*innen jeden Geschlechts, ob innerhalb oder außerhalb des binären Systems, willkommen, Quidditch zu spielen.“. (Randnotiz: 36 offizielle Teams listet der DQB aktuell auf, 12 weitere sind Entwicklungsmitglieder oder im Aufbau.)
Für den Breitensport ist der Megatrend fast eine geringere Herausforderung als für den Spitzensport, der in seinen institutionellen Vorgaben und Richtlinien global gefangen zu sein scheint. Während über den Spitzensport jedoch neue Rollen wesentlich leichter kommuniziert werden können, haben Sport- und Turnvereine heute die Chance, diese konkret umzusetzen. Angebote können dabei paradox erscheinen: Unisex und female Empowerment müssen sich nicht ausschließen. Zumindest solange nicht, bis Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern kein Thema mehr ist.