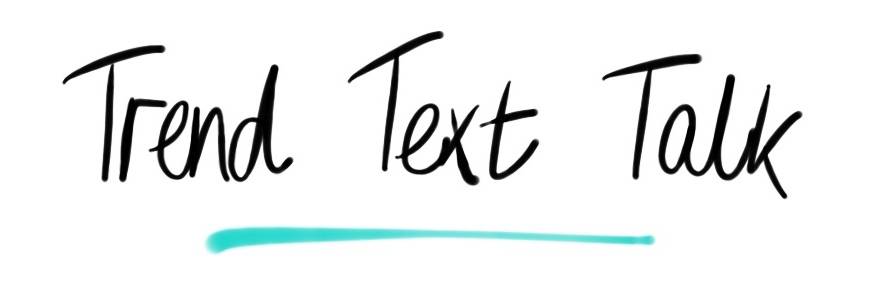Der Megatrend Individualisierung verändert sich. Eine Wir-Kultur erhält darin eine neue Bedeutung. Sich auf dem „Gemeinschaftsgedanken“ ausruhen, wäre allerdings ein Fehler.
Unsere Gesellschaft ist seit Jahren in einem extrem starken Individualisierungsprozess. Nicht oft genug sollte dabei erwähnt werden, dass es nicht primär um ein Wachstum an Selfie-Kultur, Eigen-Performance und Egoismus geht, sondern vor allem Freiheit bedeutet. Eine zunehmende Freiheit, das Leben jenseits von vorgegebenen Normen, Kulturen und Rollen zu gestalten. Die Freiheit, etwas anders zu machen als vorher, etwas anders zu machen als andere.
Diese Entwicklung hat das “Ich” immer mehr in den Mittelpunkt von Lebensinhalten gestellt. Mit vielen Vorteilen für die einzelne Person und gleichzeitig Herausforderung sowohl auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene. Denn immer mehr Optionalitäten und Möglichkeiten bedeuten, dass Entscheidungen für oder gegen etwas getroffen werden müssen. Es führt zu einer Kultur, in der Dauerhaftigkeit zunehmend schwindet und Spontaneität wie Veränderlichkeit zunehmen.
Die persönliche Entwicklung steht für den Einzelnen im Vordergrund. Die Verantwortung zu dieser aber auch. Nicht länger die Gesellschaft mit ihren Normen, Kulturen und Rollen kann dafür verantwortlich gemacht werden (zumindest nicht mehr in dem Maße wie früher, Baustellen bleiben), sondern es obliegt zunehmend der Eigenverantwortung. Das wachsende gesellschaftliche Interesse an Themen wie Balance, Achtsamkeit, Self-Care oder Resilienz sind Konsequenzen. Sie sollen die innere Stabilität stärken helfen.
Ausdifferenzierung der Gesellschaft
Eine weitere Konsequenz der Individualisierung ist die Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Wenn vorgegebene Gruppen wegfallen, die Nischen immer vielfältiger werden, entsteht ein Mangel an Zugehörigkeitsgefühl. Neue Gruppen und Tribes formen sich, Zusammenschlüsse die informeller sind oder temporär bewusst gewählt werden. Als Individuum habe ich damit die Möglichkeit und die Schwierigkeit Gruppen zu finden, in denen ich Gemeinschaft erleben kann. Dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft ist ein tief menschliches. Es mag bei jedem anders stark ausgeprägt sein, aber man kann sagen: wir sind soziale Wesen.
In den vergangenen Jahren ist nun die Entwicklung zu beobachten, dass sich Menschen wieder diesem sozialen Aspekt zuwenden – von gemeinschaftlichen Wohnformen über Co-Workation bis Meet-Up-Interessensgruppen. Eine wachsende Wir-Kultur ist spürbar.
Die Gefahr der Wir-Falle ist gegeben
Was verstehe ich darunter? Vor allem ein Ausruhen auf: „Gemeinschaft? Das ist schon immer unsere Stärke und Qualität“. Dadurch wird der Wandel verkannt, dass Post-Individualisierung kein Zurück zu alten Gemeinschaftsformen ist, sondern eine neue Wir-Kultur schafft. Sie besteht nicht aus Homogenisierung, sondern aus einer Netzwerkstruktur, eines Kollaborationsgedankens, eines gemeinsamen Wachsens aus der Verschiedenartigkeit. Weder Schneeflockendasein noch Gleichschaltung sind die Zukunft, sondern ein Miteinander der individuellen Menschen. Die Divergenz zwischen dem Ich und Wir löst sich damit in der Post-Individualisierung auf. Die Entwicklung wird weiter dahin gehen, dass beides parallel, miteinander vernetzt ist.
Take-Away: Wer bisher Gemeinschaft als Qualität und Kernprodukt hatte, wird das in Zukunft auch als Ressource nutzen können, nur in neuer Form. Die Ansprache, Generierung und Nutzung der neuen Wir-Kulturen muss die weiterhin existente Individualisierung integrieren. Wir-Kultur ist nicht Kollektiv, keine einheitliche Masse. Wir-Kultur ist ein Netzwerk aus Individuen, die mit ihren persönlichen Biographien und Haltungen gemeinsam etwas erschaffen.
Für wen relevant?
Tourismus, Sport, Event, Freizeit
Sie möchten mehr dazu erfahren, wie sich die Post-Individualisierung auf Ihre Zielgruppe, Ihre Kommunikation und Ihre Organisation auswirkt? Dann freue ich mich darauf, von Ihnen zu hören!