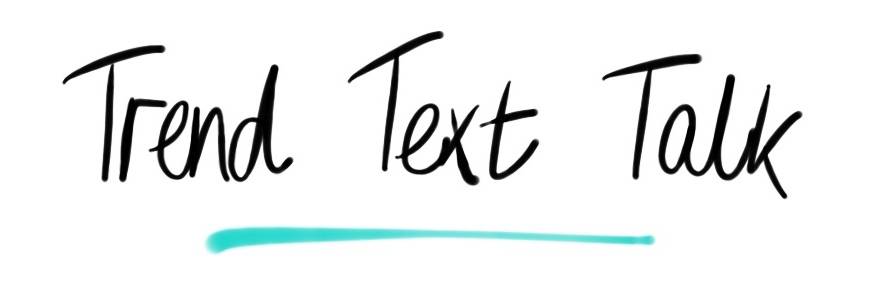Mit dem Herbstwetter ist der klassische Urlaubs-Sommertourismus als aufgeregt-nervöses Thema aus den Covid-19-geprägten Medien verschwunden. So viel ist klar: Die Pandemie erforderte und erfordert weiterhin ein grundlegend verändertes Reiseverhalten. Doch wie werden die Konsequenzen mittel- und langfristig für die Tourismusbranche sein? Welche Trends kristallisieren sich heraus?
Sich vor Corona in einem Dauerhoch wähnend, verzeichnet die Tourismus-Industrie aktuell eine ihrer tiefsten Krisen überhaupt. Die Auswirkungen der Pandemie sind in kaum einer anderen Branche derart sicht- und spürbar: Einer von zehn Jobs weltweit hing vor der Krise unmittelbar mit der Tourismuswirtschaft zusammen und die Umsätze machten 10% des globalen BIP aus (Quelle: WTTC).
Pandemie beschleunigt Trendphänomene
Doch mit Klimawandel, Over- bzw. Undertourismus – oder auch veränderten Reisemotiven durch gesellschaftlichen Wandel – kamen schon vor dem Ausbruch der Pandemie extreme Herausforderungen auf die Branche zu. Und so waren viele Trendentwicklungen, die im Sommer 2020 gerne von den Medien als “neu” herausgestellt wurden, bereits „vor Corona“ zu beobachten. Und eine Vielzahl der durch die Pandemie hervorgerufenen Alltagsveränderungen beschleunigen diese Phänomene.
Gegentrends veränderten bereits vor der Krise die Märkte
Aus dem Überangebot der Möglichkeiten, der zunehmenden Belanglosigkeit des Ziels, dem kaum noch weißen Fleck auf den Karten und der damit verbundenen Hyperkomplexität entwickelten sich Reisetrends, die als Regional, Slow Tourism oder auch Outdoor-Urlaub bezeichnet werden. Die Sehnsucht der Reisenden nach Entschleunigung, einem Anker und „authentischen“ Begegnungen machten auch bodengebundenes Reisen wieder attraktiv. Wandern und Radurlaub, Zug und Vanlife stehen heute und künftig mehr für Abenteuer und Exotik als die Fernreise und Backpacking auf fremden Kontinenten. Zudem setzt sich eine neue Generation Reisender vermehrt mit Folgen und Konsequenzen des Reisens auf den Klimawandel auseinander. Ohne dabei auf den globalen Austausch und das Unterwegssein verzichten zu wollen.
Reisemotive im Wandel: Von Erholung über Erlebnis hin zu Erfahrung
Eine zunehmende Flexibilität in Arbeitsorten und -zeiten sowie einer damit einhergehenden Vermischung von Freizeit und Arbeit, lässt Unterwegssein, Reisen (sogar während der Pandemie) immer variabler gestalten. Die einstige Rolle des Urlaubs, der Regeneration von der oft physisch anstrengenden Lohnarbeit, trifft auf eine wachsende Gruppe von Menschen nicht mehr zu. Entwicklungen wie durch Industrie 4.0, mehr Automatisierung sowie Dezentralisierung in Produktion, aber auch durch die Neubewertungen von Konsum und Wachstum, lassen diese Gruppe künftig weiter anwachsen. Global wird “Home-Office” auch in einer Post-Covid-19-Ära sich mehr und mehr etablieren. Eine Option, theoretisch temporär von überall arbeiten und leben zu können.
Während die Erholung in den letzten Jahren vor allem von dem Motiv „Erlebnis“ abgelöst wurde, wird künftig mehr denn je der Wunsch nach nachhaltigen Veränderungen im Mittelpunkt stehen.
Als Resonanztourismus wird dieses Trendphänomen im Tourismus beschrieben, das vor Corona beobachtbar war, und speziell auch „nach“ Corona weiter wachsen wird. Verkürzt gesagt, geht es bei diesem Phänomen um Transformation durch Beziehung zu andren Menschen auf Reisen, aber auch durch Beziehungen zu Themen oder Materie, Natur oder Kultur. Diese Resonanzräume können angeboten werden, eine solche Erfahrung selbst, ist jedoch nicht zu erzwingen. Diese Resonanzräume sind für den klassischen “Feriengast” ebenso wichtig zu eröffnen wie für die Home-Office-Tätigen in ihrer Arbeit-Freizeit-Schleife oder jene, die primär mit beruflichen, familiären Verpflichtungen unterwegs sind.
Die Branche muss zum Gast kommen und nicht der Gast zum Ort
Diese Resonanzräume werden somit auch im Kontext der MICE-Branche wichtig werden. Geprägt von einem veränderten Nutzungsverhalten, das sich auch nach Corona in mehr hybriden Formaten äußern wird. Hier wird aktuell viel ausprobiert, feststeht, dass in der Meeting-, Incentive, Event- und Kongress-Industrie ein „zurück“ in keinem Fall stattfinden wird. Die Anstrengungen sollten daher dahin gehen, zu erarbeiten, wie digitale Resonanzräume die Präsenzveranstaltungen ersetzen und ergänzen. Kein „wie bekomme ich wieder mehr Gäste an meinen Ort“, sondern wie kann mein Ort den Kunden und Gast erreichen, wird die Devise sein.
Auswirkungen der Trends auf die Destinationen
Für die Tourismusbranche wird in Zukunft die Herausforderung darin bestehen, den Spagat zwischen der Masse an Reisenden, deren neuen Motiven sowie dem Erhalten der Ressource des Standorts zu bewältigen. Tourismus ist für viele Länder in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Leitindustrie geworden, von der das Wirtschaftsgefüge abhängt. Regionen profitieren von der Infrastruktur, Tourismus kann für Wohlstand sorgen. Kann, denn bisher profitiert bei weitem nicht jede*r. Der „Fast Tourism“ ist vergleichbar mit Fast Fashion (zumindest nach den aktuellen Prinzipien) nur durch einen nicht nachhaltigen, ethisch fragwürdigen Umgang mit Mensch und Natur möglich.
Wichtig wird daher sein, eine so genannte „Shared Identity“ zu entwickeln. In denen nicht nur die Gemeinden, Orte und Destinationen gemeinsam agieren, sondern eben auch das bisher trennende Denken zwischen Einwohner versus Fremden, Anwohner versus Gast, Arbeit versus Freizeit, Wirtschaft versus Konsument sowie nicht zuletzt Mensch versus Natur aufgehoben wird.
Es wird keine Patentrezepte geben
Unterwegssein und Beziehungen aufbauen wird in einer globalen, kosmopolitischen Welt auch nach Corona elementar bleiben. Wenn auch unter anderen Bedingungen und mit bleibenden Herausforderungen. Kollaboration statt Konkurrenz sollte dabei zum obersten Prinzip werden. Die aktuelle Phase darf sich daher nicht darum drehen, wie ein Prä-Corona-Zustand wiederhergestellt werden kann, sondern welche Stellschrauben jetzt gedreht werden müssen, um nachhaltig wirtschaftlich, ökologisch und auch technologisch für eine Post-Corona-Reisewelt gewappnet zu sein.