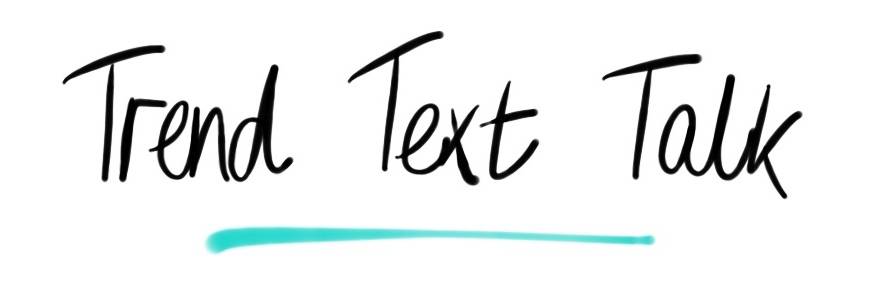Emotionen: Vor einigen Wochen bekam ich eine Interviewanfrage zum Thema “Borrowed Emotions” des im Januar erscheinenden Magazins der Berliner Modemesse Seek. Ein hochspannendes Thema, und – je länger ich darüber nachdachte – hochkomplex. Bisher hatte mich das Thema vor dem Hintergrund “Glücksforschung” und “Moodness” (vgl. z.B. Trendreport 2012, Zukunftsinstiut, 2011) oder auch Mood-Food beschäftigt. Ebenso natürlich waren mir die Emotionsclaims großer Marken aufgefallen, welche mit den Gefühlen spielen, wie McDonalds mit “Ich liebe es”, Coca-Cola mit “Taste the Feeling” oder Edeka mit “Wir lieben Lebensmittel”. Beim Blick in die Zeitschriftenregale werde ich von Mindstyle Magazinen und “Glücklich-werden”-Titeln fast erschlagen. Fast scheint es so, dass die Themen Fettfrei und Fitness von Gefühl und Glück abgelöst werden.
Doch was ist nun mit dem Gefühl jenseits von Marketing und Medien und was hat es mit “geliehenen Gefühle” auf sich? Lagern wir Gefühle auf Emoticons aus und verschleiern oder motzen wir unsere Emotionen mit einem Instagramfilter auf? Leiden wir verstärkt mit, weil soziale Medien und RSS-Newsfeeds uns ständig mit allen Katastrophen dieser Welt bombadieren? Lassen wir uns durch Apps unsere Gefühle erklären und tracken, um uns selbst besser zu verstehen – oder zu trainieren? Ergeben sich zukünftig neue Gefühle, etwa durch die Globalisierung?
Von der Heulsuse zum Feel-good-Manager
Meine Wahrnehmung ist (alles was ich jetzt schreibe, sind erste Gedanken und nichts “Fertiges”) , dass die Gesellschaft in unseren Breitengraden eine unglaubliche Sehnsucht nach Gefühl prägt und die im starken Kontrast zu – beispielsweise der Nachkriegszeit und dem ausgehenden 20. Jahrhundert – steht. Emotionen zu zeigen hatte lange keine Berechtigung, wurde entweder als etwas “Weibliches” (Heulsuse, hysterisches Weib) bagatellisiert, als einfältig beschrieben (Hans im Glück) oder die Gefühle wurden “weggeredet” (Indianer kennt keinen Schmerz). Sie hatten keinen Platz, äußerten sich wenn in Wut (wie im Rahmen der Neuen Sozialen Bewegungen) oder in psychodelisch, verklärten Liebesbotschaften und Aussteigertum der Hippies. Die Entwicklung “hin zum Gefühl” hat natürlich nicht erst gestern begonnen. Mit vorne dabei waren in den letzten Jahren die Positive Psychologie sowie die Glücksforschung. Beides geht stark mit einer neoliberalistischen Vorstellung der Selbstoptimierung und -verantwortung des Individuums einher, für die eigene Zufriedenheit zu sorgen. Erst mit dem Burn-Out wurden negative Gemütszustände salonfähig und zumindest einigermaßen respektiert. Wer zuviel gearbeitet und dafür zu wenig Wertschäftzung erfahren hat, darf sich schlecht fühlen. An dieser Stelle setzen heute so genannte Feel-good-manager an, die für eine zufriedenstellende Arbeitskultur sorgen sollen.
Annäherung an Emotionen mittels Mindfulness und Tracking-Devices
Doch zwischen Glück und Burn Out, Wut und Liebe gibt es eine Vielzahl an Emotionen, denen sich die Gesellschaft derzeit mit mehr oder weniger neuen Methoden annähert. Nicht zuletzt die mittlerweile fast gesellschaftliche Verpflichtung zu “Mindfulness” und “Meditation” zeigt, wie sehr es das Bedürfnis gibt, sich dem eigenen Erleben und Befinden zu nähern (und es gleichzeitig im neoliberalen Kontext “zu kontrollieren”). Zahlreiche Apps erleichtertn heutzutage das Mood-Tracking. Online werden Stimmungen via Moodpath, Pacifica oder eines Emotions-Wearables festgehalten. Während es meist um Ängste, Depressionen, Impulsivität oder Manie geht, hat der Emotion Tracker höhere Ansprüche: “We will make emotions understandable for everyone”, so das Ziel.
Globalisierung und Digitalisierung fördern Emotionsvielfalt
Und sicherlich liegt hier eine der Herausforderungen unserer Zeit: Gefühle verstehen, Emotionen einsetzen, Stimmungen deuten. Gerade das Netz ist hier eine bunte Spielwiese, wenn Emoticons uns eine Palette an Gefühlen anbieten, die zuvor mit einfachen Doppelpunkt-Bindestrich-Klammer-Smileys nahezu undenkbar waren. Die Palette stellt den User vor zwei Herausforderungen, zum einen die Frage nach, was fühle ich und zum anderen auch, welches Symbol dieses aktuelle Gefühl am besten ausdrückt. Die Reduzierung auf Icons vereinfacht zwar weltweit die Kommunikation, bietet aber auch Raum für Mißverständnisse. Nicht zuletzt auch, weil andere Länder, andere Gefühle kennen.
Nachfrage nach Tools und Ideen wird steigen
Von einer Gefühllosigkeit kann derzeit also keine Rede sein, sondern eher ein Phase, in der wild ausprobiert und noch so einiges unverständlich ist. Während derzeit immer noch das Mantra des Positiven Denkens den Mainstream durchflutet, wächst gleichzeitig die Sehnsucht nach einem Sich-Fühlen mit allen Schattierungen der Farbpalette. Um dies zu erreichen, werden Gefühle mitunter auch “geliehen” oder versucht zu verstärken. Ebenso wie sie durch Tools und Tricks gezähmt werden. Mittels neuer Technolgien wird die Bandbreite an Angeboten und Möglichkeiten steigen wird. Eine App ist bereits in Planung, die mit Gesichts- und Emotionserkennung dem User das für seine Gemütslage richtige Essen vorschlägt.